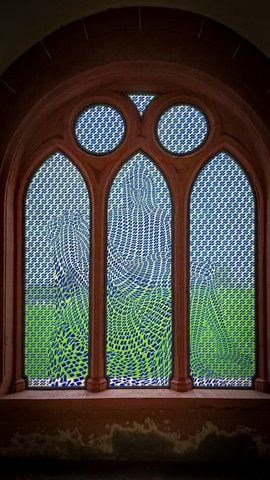Als sich Starregisseur Jean-Jaques Annaud und Produzent Bernd Eichinger Mitte der 1980er Jahre auf die Suche nach einer passenden Anlage für ihre Verfilmung des Umberto-Eco-Klassikers "Der Name der Rose" begaben, war es für Kloster Eberbach der Beginn einer Weltkarriere als Leinwand-Star.
Denn die meisterhafte Inszenierung dieses Bestsellers im Winterhalbjahr 1985/ 86 mit Sean Connery in der Hauptrolle und ihre Ausstrahlung machten Kloster Eberbach mit einem Schlag auf dem gesamten Globus berühmt.
Das Kloster Eberbach (auch Kloster Erbach; lateinisch Abbatia Eberbacensis) ist eine ehemalige Zisterzienserabtei in Eltville am Rhein im Rheingau, Hessen. Das für seinen Weinbau berühmte Kloster war eine der ältesten und bedeutendsten Zisterzen in Deutschland. Die im Naturpark Rhein-Taunus gelegene Anlage zählt mit ihren romanischen und frühgotischen Bauten zu den bedeutendsten Kunstdenkmälern Europas.
Geschichte
Gründung und Aufstieg (12./13. Jahrhundert)
Die Gründung des Zisterzienserklosters in Eberbach geht auf Bernhard von Clairvaux zurück. Nach der Gründung des Klosters Himmerod 1135 in der Eifel war das Kloster Clairvaux des Zisterzienserordens um ein weiteres Tochterkloster in Deutschland bemüht. So kam es am 13. Februar 1136 zur Gründung des Klosters Eberbach durch Abt Ruthard und 12 Mönche, die aus Clairvaux entsandt worden waren. Das Kloster stand unter dem Patrozinium der Maria Immaculata und hatte das Nebenpatrozinium Johannes der Täufer. Diese beiden Klöster wurden durch die Primarabtei Clairvaux gegründet, fast alle anderen Zisterzienserklöster in Deutschland durch die burgundische Primarabtei Morimond.[1]
Grundstock des Klosters Eberbach war ein 1116 von Mainzer Bischof Adalbert I. von Saarbrücken gegründetes Augustiner-Chorherren-Stift. Dessen Patron war der heilige Thomas. Das Stift wurde jedoch von Adalbert wegen angeblicher Zuchtlosigkeit 1131 von dort wieder vertrieben und siedelte nach St. Ägidius in Mittelheim um. Die Gebäude des Stifts wurden vorübergehend für eine Priorei des Klosters Johannisberg genutzt. So konnten die Zisterzienser die aufgelassenen Gebäude beziehen und davon ausgehend ein neues Kloster nach zisterziensischen Idealvorstellungen aufbauen.[2]
Schnell entwickelte sich das Kloster Eberbach. Bereits 1142 erfolgte die Gründung des Tochterklosters Schönau im Odenwald. Zu diesem Zeitpunkt musste, nach den Statuten der Zisterzienser, das Kloster Eberbach bereits über mehr als 60 Mönche verfügen. 1144/1145 erfolgte die Gründung des Tochterklosters Otterberg in der Pfalz und 1155 jene des Tochterklosters Hocht, später Gottesthal (Val-Dieu) bei Lüttich.
Eine erste Krise durchlebte Eberbach während der Kirchenspaltung um 1160 bis 1170.[2] Der Zisterzienserorden unterstützte Papst Alexander III. gegen die Päpste des staufischen Kaisers Friedrich Barbarossa. Wie der Mainzer Erzbischof Konrad I. von Wittelsbach floh der Eberbacher Abt nach Rom. Weitere Mönche flohen vorübergehend nach Frankreich. Sie kehrten nach wenigen Jahren in das aufstrebende Kloster zurück.
Im Jahr 1174 erfolgte die Gründung des Tochterklosters Arnsburg in der Wetterau.
Ein von Eberbach und seinem Tochterkloster Schönau im frühen 13. Jahrhundert geplantes Tochterkloster im Königreich Sizilien konnte nicht gegründet werden. Die Planung erfolgte unter Abt Theobald, der zuvor Abt des Klosters Schönau gewesen war. Dem Generalkapitel lag die Planung vor. Die Äbte von Casamari und Fossanova waren beauftragt, die Umsetzung zu prüfen. Allerdings kam es 1217 zu einer Übersiedlung mehrerer Mönche zum Kloster Sambucina, einem Tochterkloster von Casamari.[3]
Von 1232 bis 1234 besetzte Erzbischof Siegfried III. von Eppstein das Kloster Lorsch mit Mönchen aus Eberbach. Das bisherige Kloster der Benediktiner sollte nach den Regeln der Zisterzienser reformiert werden. Nachdem die Reformation nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hatte, wurde das Kloster Lorsch an die Prämonstratenser übergeben. In der Zeit der Besetzung wurden 35 karolingische Handschriften in die Bibliothek des Klosters Eberbach verbracht.[4]
Eine weitere geplante Klostergründung im Hanauer Wald um 1234 vereitelten die Grafen von Hanau.